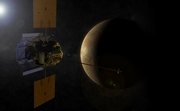Sowohl mit Teleskopen als auch mit Raumsonden ist seine Erforschung schwierig
Während die Planeten Venus, Mars, Jupiter und Saturn als auffällig helle Objekte selbst für Laien leicht am Firmament aufzufinden sind, bekommen nur wenige Menschen jemals Merkur zu Gesicht. Denn der sonnennächste und zugleich kleinste Planet des Sonnensystems entfernt sich von der Erde aus gesehen maximal um 28 Grad von der Sonne. Deshalb erscheint er nur entweder in der Morgen- oder Abenddämmerung als schwaches Lichtpünktchen wenige Grad über dem Horizont.
Merkur hat einen Durchmesser von nur 4880 Kilometern und enthält einen Eisenkern, der etwa 85 seines Durchmessers ausmacht. Vermutlich hat die starke Strahlung der Sonne einen großen Teil der leichteren Elemente bei der Entstehung des Planeten fortgeblasen, sodass fast nur der schwere metallische Kern zurückblieb. Die durchschnittliche Entfernung des Planeten von der Sonne beträgt 58 Millionen Kilometer. Durch die Sonnennähe und das Fehlen einer dichten Atmosphäre herrschen auf der Oberfläche extreme Temperaturschwankungen. Tagsüber wird es bis zu 430 Grad Celsius heiß, während es nachts auf minus 180 Grad abkühlt.
Die Umlaufbahn von Merkur ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich: Sie ist stärker elliptisch als die aller anderen großen Planeten, und sie ist stärker als die Bahnen der anderen Planeten gegen die Ekliptik, also die Bahnebene der Erde, geneigt.
Und es gibt noch eine Besonderheit, die den Himmelsforschern lange Zeit Kopfzerbrechen bereitete: Die Ellipse, auf der sich Merkur bewegt, dreht sich. „Periheldrehung“ nennen die Astronomen dieses Phänomen, wobei „Perihel“ die Bezeichnung für den sonnennächsten Punkt der Bahn ist. Zwar ist eine solche Drehung aufgrund der Anziehungskraft der anderen Planeten auf den kleinen Merkur zu erwarten. Doch allein mit diesem Einfluss ließ sich – im Rahmen der Newtonschen Gravitationstheorie – die Periheldrehung nicht vollständig erklären. Die Astronomen vermuteten deshalb einen weiteren, noch näher an der Sonne liegenden Planeten als Ursache. Doch die Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein lieferte schließlich eine andere Erklärung: Die Masse der Sonne verzerrt die Raumzeit auf Höhe der Merkurbahn bereits so stark, dass die Zeit dort ein klein wenig langsamer verläuft – und das führt zu einer zusätzlichen Drehung der Bahnellipse.
Die Erforschung von Merkur ist aufgrund der Sonnennähe sowohl mit Teleskopen als auch mit Raumsonden eine Herausforderung. Die erste Raumsonde, die Merkur erreichte, war Mariner 10 im Jahr 1974. Sie flog dreimal an dem Planeten vorüber und lieferte erstmals Nahaufnahmen. Im März 2011 schwenkte mit Messenger erstmals eine Raumsonde in eine Umlaufbahn um Merkur ein. Eine der wichtigsten und überraschendsten Entdeckungen von Messenger war der Nachweis von Wassereis in Kratern am Nordpol des Planeten.
Derzeit befindet sich die europäisch-japanische Sonde BepiColombo auf dem Weg zum Merkur. Im November 2026 soll sie in eine Umlaufbahn um den Planeten einschwenken.
Bildquelle: NASA